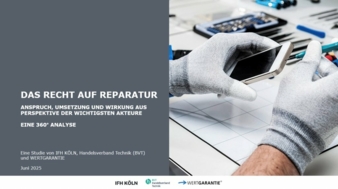05.09.25 – IFH Köln, BVT und Wertgarantie
Studie zeigt Herausforderungen beim „Recht auf Reparatur“
Eine 360°-Studie hat Verbraucher, Fachhändler und Hersteller sowie die Ersatzteilwirtschaft zur EU-Richtlinie „Recht auf Reparatur“ befragt und zeigt dabei Chancen, aber auch große Herausforderungen auf.
Bis spätestens 31. Juli 2026 muss die Europäische Richtlinie zum „Recht auf Reparatur“ in deutsches Recht umgesetzt werden. Sie hat das Ziel, Elektroabfälle zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. In Deutschland werden aktuell etwas weniger als die Hälfte der defekten Elektrogeräte der in der Richtlinie erwähnten Produktgruppen (49 %) nicht repariert. Im Auftrag des Handelsverbands Technik (BVT) und des Spezialversicherers Wertgarantie hat das IFH Köln die Sicht darauf von Verbrauchern, Herstellern, vom Fachhandel und von der Ersatzteilwirtschaft in Deutschland erstmalig empirisch untersucht und bietet damit einen 360°-Blick auf die potenziellen Auswirkungen auf das Reparaturgeschehen.
Die Studie „Das Recht auf Reparatur: Anspruch, Umsetzung und Wirkung aus Perspektive der wichtigsten Akteure“ basiert auf einer quantitativen Befragung von Verbrauchern (repräsentativ), Fachhändlern, Herstellern und Gesprächen mit Unternehmen der Ersatzteilwirtschaft. Dafür wurden im ersten Halbjahr 2025 befragt: 4.131 Verbraucher, 164 Betriebe aus dem Fachhandel (die Elektro- und Haushaltsgeräte vertreiben), 20 von 31 relevanten Herstellern von Elektro- und Haushaltsgeräten und sechs Unternehmen der Ersatzteilwirtschaft.
Unwissen zum „Recht auf Reparatur“
Allem voran zeige sich deutlich, dass das „Recht auf Reparatur“ bei den Verbrauchern bisher noch wenig bekannt ist. Von den Verbrauchern, die schon einmal davon gehört haben (44 %), weiß knapp ein Drittel (35 %), worum es im Einzelnen geht. Bei den befragten Fachhändlern kennen 98 % und bei den Herstellern 95 % die EU-Richtlinie, im Detail informiert darüber sind im Fachhandel 55 % und bei den Herstellern 95 %.
Hersteller und Handel sehen große Herausforderungen
Laut der Studie empfinden Fachhändler und Hersteller die Regelung rund um das „Recht auf Reparatur“ prinzipiell als Chance, um etwa Kontaktpunkte zu Kunden zu erhöhen oder auch ihr Serviceangebot zu erweitern. Allerdings überwiegen für einen Großteil der Befragten aus diesen Gruppen die Herausforderungen: So bewerten die in der Richtlinie geforderte Verlängerung der Gewährleistung nach erfolgter Reparatur 70 % der Fachhändler und knapp zwei Drittel der Hersteller (63 %) als schwierig. Über die Hälfte der Fachhändler (56 %) und knapp ein Drittel der Hersteller (32 %) befürchten einen Mehraufwand durch die engere Zusammenarbeit mit Reparaturpartnern.
Entscheiden sich Verbraucher dafür, ihr defektes Gerät (aus einer der in der EU-Richtlinie genannten Produktgruppen) reparieren zu lassen, gibt knapp die Hälfte an, den Kundendienst des Herstellers zu nutzen und knapp ein Viertel, den Fachhandel für Elektrogeräte. In Folge der Richtlinie gehen mehr als die Hälfte der Hersteller (56 %) und des Fachhandels (52 %) davon aus, dass ihr eigenes Reparaturvolumen steigen wird. Fast drei Viertel der befragten Fachhändler (74 %) und knapp die Hälfte der befragten Hersteller (40 %) äußern jedoch, mit den aktuell vorhandenen Ressourcen nicht oder nur teilweise auch ein größeres Reparaturvolumen umsetzen zu können.
Laut den Studienautoren sind sich Handel und Industrie daher einig, dass der Fachkräftemangel eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung des „Rechts auf Reparatur“ sei. Daher sei eine wirkungsvolle Förderung von notwendiger Aus- und Weiterbildung durch die Politik gefordert, denn nur mit ausreichend qualifiziertem Personal könnten die wachsenden Reparaturwünsche der Kunden erfüllt werden.
Steigende Kosten befürchtet
In Folge der Umsetzung der Richtlinie zum „Recht auf Reparatur“ gehen jeweils über 60 % der Fachhandelsunternehmen (68 %) und der Hersteller (63 %) davon aus, dass die Kosten für eine Reparatur steigen werden. Hersteller und Fachhändler geben dafür ähnliche, teils aber unterschiedlich gewichtete Gründe an. So sehen Fachhändler unter anderem die Erhöhung der Preise für Ersatzteile durch Hersteller (68 %), einen zusätzlichen Personalaufwand für Serviceleistungen (58 %) und zusätzliche Kosten für die Lagerung von Ersatzteilen (52 %) als wichtigste Gründe für steigende Reparaturpreise an. Die Mehrheit der befragten Hersteller sieht im zusätzlichen Personalaufwand für Serviceleistungen (92 %), in zusätzlichen Kosten für die Lagerung von Ersatzteilen (83 %) und in zusätzlichen Kosten durch die Vorhaltung von diesen (75 %) die drei größten Preistreiber für Reparaturen.
Die Studienautoren unterstreichen daher die Notwendigkeit von nationalen Maßnahmen zur Abmilderung von möglichen Teuerungen, um die Reparaturbereitschaft weiterhin zu fördern.
Die gesamte Studie kann hier kostenfrei heruntergeladen werden.